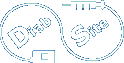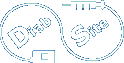Prinzipien der
Prinzipien der
Health On the Net Foundation.
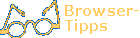
|
| |
Die elektronische Gesundheitskarte soll für schnellen Informationsaustausch
zwischen Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern sorgen
 In Deutschland sterben jedes Jahr rund 10.000 Menschen,
so schätzen Experten, an unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln. Das sind mehr Tote durch
Arzneimittel als durch Unfälle im Straßenverkehr. Der Grund: Ärzte wissen nicht immer, was andere
Kollegen dem Patienten bereits verordnet haben.
In Deutschland sterben jedes Jahr rund 10.000 Menschen,
so schätzen Experten, an unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln. Das sind mehr Tote durch
Arzneimittel als durch Unfälle im Straßenverkehr. Der Grund: Ärzte wissen nicht immer, was andere
Kollegen dem Patienten bereits verordnet haben.
Forscher der TU Berlin und des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik entwickelten die
elektronische Gesundheitskarte, die Ärzten, Apotheken, Kliniken und Krankenkassen alle Informationen über
verordnete Medikamente zugänglich machen und so gefährliche Kontraindikationen vermeiden soll. Der
Prototyp mit ersten Arbeitsergebnissen wurde bereits an Gesundheitsministerin Ulla Schmidt übergeben.
80 Millionen Versicherte werden in Deutschland von 123.000 niedergelassenen Ärzten, 65.000 Zahnärzten,
22.000 Apotheken, 2.200 Kliniken und rund 300 Krankenkassen betreut. Die Einführung der
von Forschern unter Leitung von TU-Professor und ISST-Chef Prof. Dr. Herbert Weber entwickelten
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gilt in Deutschland als wegweisende Innovation, die der
deutschen IT-Industrie auch Perspektiven und Chancen im Ausland eröffnet. Dabei geht es nicht nur um
die Entwicklung der Lösungsarchitektur der Karte. Um die letztlich angestrebte Vernetzung der Zielgruppe
aus Millionen Menschen und Institutionen zu erreichen, muss auch eine entsprechende telematische
Infrastruktur entwickelt werden. Arzt, Apotheker oder Krankenhäuser müssen einander schließlich auf
verschiedenen Wegen Informationen übermitteln können.
In der eGK sollen alle Anamnese- und Diagnosedaten des Patienten jedem behandelnden Arzt zugänglich
gemacht werden, immer voraus gesetzt, dass der Patient selbst zustimmt. Neben den dramatischen
Kontraindikationen können dadurch auch teure Mehrfachuntersuchungen unterbleiben.

Neue Karte - neue Anwendungen
Die Rahmenbedingungen für die Einführung und die möglichen
Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte sind rechtlich durch das 2003 verabschiedete Gesetz
zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vorgegeben. Neben den Pflichtanwendungen sind
auch freiwillige Anwendungen auf der Karte vorgesehen. Zu den Pflichtanwendungen gehören die Daten zur
versicherten Person, zum Beispiel auch der Versicherungs- und Zuzahlungsstatus. Verpflichtend ist außerdem
die "elektronische Verordnung". Diese basiert auf Daten über verordnete Medikamente von Ärzten
oder Apotheken. Ein Rezept kann ausgedruckt werden, die elektronische Form sichert aber die reibungslose
Abwicklung zwischen Ärzten, Apotheken und Versicherungen sowie einen reduzierten Bearbeitungsaufwand.
Experten schätzen die möglichen Einsparungen auf über 80 Millionen Euro pro Jahr.
Das persönliche Arzneimittelregister und die elektronische Patientenakte gehören zu den freiwilligen
Anwendungen, die insbesondere bei einer Notfallbehandlung zum Tragen kommen könnten. Das Recht des
Versicherten den Zugang zu gestatten oder abzulehnen muss dabei gewahrt bleiben. Datenschutz und
Versorgungssicherheit könnten hier insbesondere bei einer Notfallbehandlung schnell in Konflikt geraten.
Deshalb muss die telematische Infrastruktur auch Vorkehrungen zur Lösung solcher Konflikte treffen.
Das Projekt hat viele innovative Lösungen für viele technische, insbesondere auch sicherheitstechnische
Probleme geschaffen. Um die elektronische Karte nutzen zu können, muss ein entsprechendes Informations-
und Kommunikationssystem entwickelt werden, das die IT-Systeme der Praxen, Apotheken und Krankenhäuser
in Deutschland umfasst und die reibungslose Kommunikation ermöglicht. Ein spezielles Sicherheitskonzept
beschränkt den Zugriff, schützt den Datentransfer und somit die Patientendaten. Eine besondere
Herausforderung war auch die Nachhaltigkeit. Nutzeranforderungen verändern sich beständig, ebenso wie
Technologien. Eine Reihe von "Stellschrauben" sorgt daher für die Möglichkeit von Anpassungen, Nach-
und Hochrüstungen bei veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen.
Der Aufwand, dieses Projekt zu realisieren, war nicht unerheblich. Die 35 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Fraunhofer-Projektteams wurden zeitweilig von bis zu 100 weiteren Mitarbeitern
aus Gesundheitsorganisationen und aus der Industrie unterstützt. Ein weiteres Projektteam stand im
Bundesgesundheitsministerium bereit. Nun stehen die Ergebnisse zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
Pressemitteilung: Technische Universität Berlin.

13.09.2005
Archiv 2005
- Nachrichten zur Gesundheitspolitik
|
|