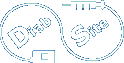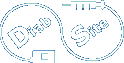Prinzipien der
Prinzipien der
Health On the Net Foundation.
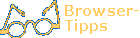
|
| |
Für eine neue Balance von Qualitätssicherung und Datenschutz
G-BA fordert klare datenschutzrechtliche Grundlagen für eine wirksame Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen gehört zu den
zentralen Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA): Das gemeinsame Gremium der Ärzte,
Krankenhäuser und Krankenkassen hat die einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung
ebenso zu regeln wie beispielsweise die Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement.
Desgleichen ist der G-BA für die Bestimmung der Kriterien und Verfahren von Stichprobenprüfungen der
medizinischen Leistungen zuständig. Nicht zuletzt soll der G-BA auch auf eine sektoren- und
berufsgruppenübergreifende Qualitätssicherung hinwirken.
Die Qualitätssicherung medizinischer Leistungen - etwa in Form von
Benchmarking-Berichten oder Stichprobenprüfungen - setzt die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten der Versicherten und Leistungserbringer voraus. Insbesondere
Maßnahmen zur Sicherung der Ergebnisqualität lassen sich nur auf der Grundlage von Längsschnittdaten
durchführen, die es ermöglichen, den Verlauf einer Behandlung und deren Ergebnis patientenbezogen
zu beurteilen. Dies gilt vor allem dann, wenn eine Behandlung durch mehrere Ärzte/Krankenhäuser erfolgt
oder bei chronisch kranken Patienten die Ergebnisse regelmäßig wiederkehrender Behandlungsvorgänge in
ihrer Qualität gesichert werden sollen. Grundlage hierfür sind pseudonymisierte Daten, die, soweit
erforderlich, insbesondere durch den behandelnden Arzt einen personenbezogenen Zugriff gestatten,
durch die für die Auswertung der Daten verantwortliche Stelle aber nur verschlüsselt verarbeitet werden
können.
Unbestritten ist, dass der Datenverwendung durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der
Betroffenen verfassungsrechtliche Grenzen gezogen werden. Aus gutem Grund hat der Sozialdatenschutz
im SGB V und im SGB X eine eingehende Regelung erfahren. Indessen dient auch die
Qualitätssicherung hochrangigen Zielen: Sie gewährleistet zum einen den Gesundheitsschutz der Patienten
und zum anderen die Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Daher müssten die Datenschutzvorschriften des
Sozialgesetzbuchs an sich so beschaffen sein, dass sie einer wirkungsvollen Qualitätssicherung nicht
im Wege stehen. Wie das Beispiel der Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse des G-BA zeigt, ist dies
jedoch derzeit nicht der Fall.
Der Entwurf der Dialyse-Richtlinie sieht neben Stichprobenprüfungen der Dialyse-Leistungen auch
einrichtungsübergreifende Qualitätssicherungsmaßnahmen der Dialyse-Einrichtungen vor. Die dazu
erforderlichen Datenflüsse hat der G-BA unter Beachtung der Grundsätze der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit gestaltet. Danach sollen nur so viele Sozialdaten erhoben, verarbeitet und genutzt
werden, wie dies für eine angemessene Qualitätssicherung unbedingt notwendig ist. Überdies wird
in weitem Umfang von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung der Daten Gebrauch
gemacht. Zu diesem Zweck ist eigens ein neutraler Datentreuhänder vorgesehen, der detaillierte
Sicherheitsvorgaben zu erfüllen hat.
Trotz dieses Datenschutzkonzepts soll die Richtlinie nach Ansicht des Bundes- und der Landesbeauftragten
für den Datenschutz nicht mit dem Datenschutzrecht in Einklang stehen. Deshalb haben die Fachleute
dem G-BA empfohlen, entweder eine durchgängige, mehrfach gestufte Pseudonymisierung der Patientendaten
oder die Einholung der Patienteneinwilligung in die Datenflüsse vorzuschreiben. Beide Varianten
sind aus Sicht des G-BA jedoch einer wirksamen und wirtschaftlichen Qualitätssicherung abträglich:
Während nach beiden Modellen ein unverhältnismäßiger Organisations-, Dokumentations- und
Verwaltungsaufwand entstünde, würde die Einwilligungslösung zudem die Gefahr einer nur lückenhaften
Datenerhebung bergen. Hinzu kommt, dass selbst diese Modelle unter den Datenschutzbeauftragten
rechtlich umstritten sind. Ein Teil der Experten nimmt daher an, dass sich die beabsichtigte
Qualitätssicherung nur nach einer Gesetzesänderung verwirklichen lasse.
Dabei beinhaltet schon das geltende Recht eine vollständige arzt- und versichertenbezogene
Übermittlung von Behandlungsdaten an die für den Versicherten zuständige Krankenkasse. Insoweit
wird unterstellt, dass der Versicherte mit der Aushändigung seiner Krankenversichertenkarte in
die gesetzlich geregelte Weitergabe seiner Behandlungsdaten einwilligt. Es stellt eine Überdehnung
des Datenschutzes dar, wenn für die im Interesse des Versicherten liegende Qualitätssicherung
mittels pseudonymisierter Daten jetzt zusätzliche Einwilligungserklärungen gefordert werden.
Vor diesem Hintergrund hält der G-BA eine Anpassung der sozialrechtlichen Vorschriften zum
Datenschutz für dringend geboten: Erforderlich sind klare datenschutzrechtliche Handlungsgrundlagen
für alle an der Qualitätssicherung Beteiligten. Ärzten, Krankenhäusern, Krankenkassen und deren
jeweiligen Vereinigungen sowie dem G-BA muss datenschutzrechtlich gestattet werden, was ihnen
qualitätssicherungsrechtlich aufgegeben ist. Dies gilt für die Qualitätssicherung innerhalb des
ambulanten oder des stationären Sektors ebenso wie für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung,
der das Datenschutzrecht bisher kaum Beachtung schenkt.
Aufgabe des Gesetzgebers ist es, eine angemessene Balance zwischen der informationellen
Selbstbestimmung einerseits sowie dem Gesundheitsschutz und der Wirtschaftlichkeit andererseits
herzustellen. Das Gesundheitswesen braucht Regelungen, die sowohl dem Datenschutz Rechnung tragen
als auch eine wirksame Qualitätssicherung ermöglichen!
Pressemitteilung: Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA).

20.07.2005
Archiv 2005
- Nachrichten zur Gesundheitspolitik
|
|